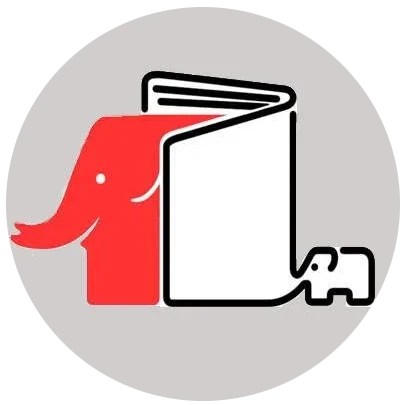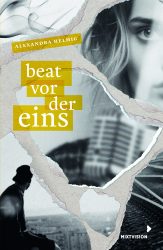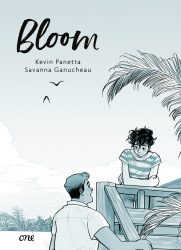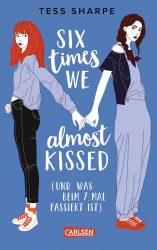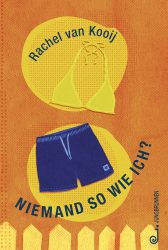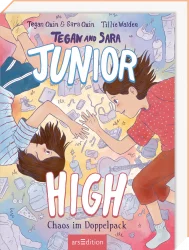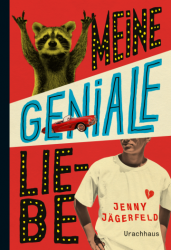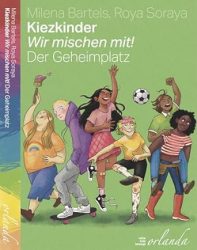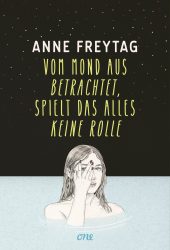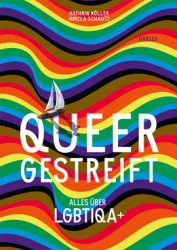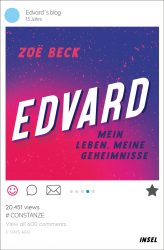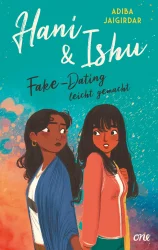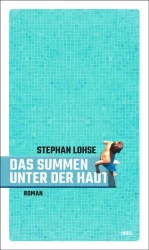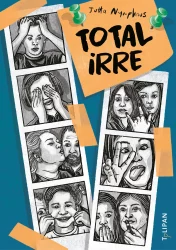Ina ist unzufrieden mit ihrem Körper, fühlt sich unsicher in der Schule und muss sich mit der scheinbar bröckelnden Ehe ihrer Elternauseinandersetzen. Auch ihre eigenen Erfahrungen mit der Liebe sind chaotisch und durchaus mehr von Unsicherheit als von Erfüllung geprägt. Im Laufe des Romans reflektiert Ina also ihre Gefühle, Ängste und Träume und beleuchtet dabei immer wieder ihre inneren Kämpfe: Seien es familiäre Probleme, schlechte Noten, das Gefühl nicht verstanden und gesehen zu werden oder die erste Liebe.
Ein guter Ansatz, typische Teenager-Probleme zu Papier zu bringen, der Welt zu zeigen, was es heißt, ein Mädchen zu sein und die Message zu verbreiten, dass wir selbst die Personen sind, die uns manchmal am besten, aber manchmal auch am wenigsten kennen.
Hierbei gefällt mir besonders, dass Helmig durch Ina unsere Gesellschaft auch mal kritisch beäugt: Funktioniert unser aktuelles Schulsystem? Was fällt alles unter sexuelle Belästigung? Sind die aktuellen Schönheitsideale erreichbar?
Meiner Meinung nach wird hier jedoch nicht genug darauf geachtet, ob alle Inhalte denn wirklich altersgerecht herübergebracht wurden: Vor allem Inas Alkohol- und Zigarettenkonsum, sowie ihr Wunsch nach einem mageren Körper wird, wie ich finde, beinahe romantisiert, ohne über diese Gewohnheiten zu reflektieren und den Lesern zu vermitteln, dass all diese nicht sonderlich erstrebenswert sind. Auch, wie die Vergewaltigung Inas durch ihren Gastvater hier extrem bildlich und nicht dem durchschnittlichen Alter der Leser*innen entsprechend (“ab 14 Jahren”) dargestellt wird. Der Umgang mit den Problemen in ihrer Familie, der vermeintlichen Schwangerschaft und die Gegenüberstellung der verschiedenen Kulturkreise wird jedoch wiederum passend dargestellt.
Nichtsdestoweniger schafft es Helmig durch ihren Roman nicht nur ein authentisches Bild eines Teenagers zu zeichnen, sondern auch die Wichtigkeit der verschiedenen Sozialisationsinstanzen zu betonen.
Darüber hinaus nimmt sie die Bezeichnung “Coming-of-Age-Roman im Sound der 90er” sehr ernst und bemüht sich stets, ihre Leserschaft zu erreichen und versucht daher sehr identifizierbar zu schreiben, was ihre Werke sehr einzigartig macht: Eine passende Playlist und das tagebuchartige Schreiben sind nur wenige Indizien dafür, dass es nicht viele Worte braucht, um auszudrücken, wie es einem ergeht, sondern nur eine/n Zuhörer*in beziehungsweise ein/e Leser*in. Dies beweist sie beispielsweise mit dem aus nur zwei Wörtern bestehenden Tagebucheintrag “105 Fehlstunden”.
Auch bei der Figurengestaltung hat Alexandra Helmig keine Mühe gescheut: Wie die meisten Teenager ist auch Ina sehr neugierig und fragt sich ständig was hinter einem Menschen wirklich steckt, ist auch mal eifersüchtig auf ihre beste Freundin Vicki, welche es schafft, “ihr Leben in die Hand zu nehmen”, strebt nach einer schöneren Figur, fühlt sich nicht verstanden, planlos und unmotiviert.
Daher spielt auch Selbstzweifel in ihrem Leben eine erhebliche Rolle: Sie bezeichnet sich selbst als impulsiv, “falsche Schlange”, “kleine Koordinate”, kritisiert ihre eigenen Körper und ihre Körperbewegungen und ist unzufrieden mit dem, was sie hat. Ihr Leben ist halt eine “Endlosschleife”.
Zudem ist sie durch die fehlende Aufmerksamkeit ihrer Mutter auf der ständigen Suche nach einer Vertrauensperson, darunter ihr Klavierlehrer, und hat es satt, für die fehlgeschlagene Beziehung ihrer Eltern verantwortlich gemacht zu werden.
Zuletzt möchte ich auch auf den besonderen Schreibstil Helmigs eingehen. Diese schreibt nämlich sehr bildlich, emotional und nutzt eine ausdrucksstarke Wortwahl und kurze gedichtartige Absätze, um die Gefühle Inas zu unterstreichen. So schreibt sie beispielsweise, dass es ihr so vorkomme, als würde selbst das “Geräusch der Toilettenspülung” ihre Worte verschlucken. Dennoch finde ich hier die Nutzung der staccatoartigen Sätze eher unpassend, da diese zwar ihr Gefühlschaos widerspiegeln und Interesse wecken sollen, aber dennoch auf Dauer sehr monoton und ermüdend wirken und durch ihre Kürze nur wenig Emotionen herüberbringen.
Ferner lässt sich sagen, dass Helmig neben der Wortwahl, auch die Satzzeichen mit Bedacht wählt: Jedes Fragezeichen, Ausrufezeichen und jeder Punkt haben eine Bedeutung. Die Alltagssprache ist jedoch das, was den Roman so lebendig und jugendlich macht.
Zuletzt fallen auch die inspirierenden Erkenntnisse Inas auf, welche dem Leser viel Interpretationsspielraum bieten. Ein Beispiel dafür wäre das Zitat “Endlich habe ich mich entschieden, etwas zu tun, von dem alle gesagt haben, mach das bloß nicht.”
Kurz: Alexandra Helmigs „Beat vor der Eins“ ist ein eindrucksvoller Coming-of-Age-Roman, der die Unsicherheiten vieler Jugendlicher widerspiegelt, zum Nachdenken über gesellschaftliche Themen anregt und daher auch als wertvoller Beitrag zur Jugendliteratur angesehen werden kann.
Sedef Nur Elgün
Ina hat mitten in der Pubertät viel zu verarbeiten: Eine durch und durch ungesunde Beziehung der Eltern, Unverständnis der Eltern ihr gegenüber, ihr Körper und auch das Thema Liebe und Jungs. In ihrem Tagebuch schreibt sie all das auf, was sie ihrem Umfeld nicht mitteilen kann. Diese Einträge offenbaren das, was anderen fehlt, um Ina wirklich zu verstehen.
Die Sätze sind kurz und trotzdem mit viel Inhalt gefüllt, aus dem sich eine Geschichte ergibt, in der sehr deutlich wird, wie stark das Fehlverhalten der Erwachsenen eigentlicher Motor für so manch als pubertär abgestempeltes Verhalten ist. Der Gastvater in Frankreich, der ihr viel zu nahekommt, der 22-Jährig Yann und die Mutter, die ihre Erwachsenen-Probleme im Plural (“Wir”) formuliert und damit tatsächlich Ina meint.
Der Titel hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, eventuell habe ich da was überlesen.
Wer aber einen kurzen, aber erkenntnisreichen Einblick in den Kopf eines Teenagers haben möchte oder sich in einem kurzen Roman wiederfinden will, ist mit diesem Roman wunderbar versorgt!
Raphaela Brosseron